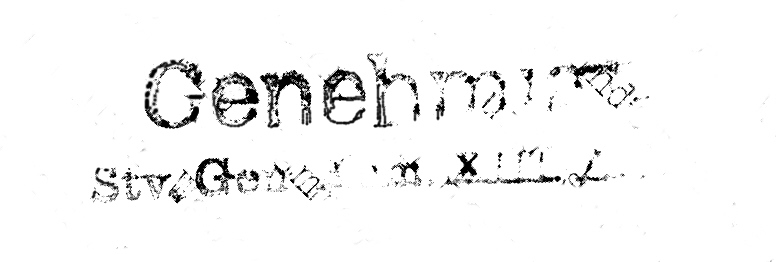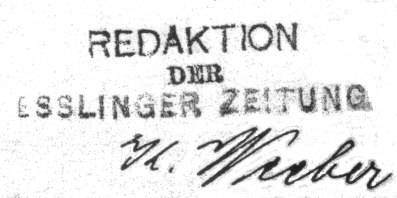Um die Berge im Sundgau – Gipfelkämpfe in den Vogesen. Aus dem Tagebuch eines Esslinger Landwehrmanns vom 25. /26. Februar 1915
Dieser Tagebuchauszug wurde am 30.Maerz 1915 durch die Esslinger Zeitung veröffentlicht. Der Bericht trägt den Stempel der Redaktion der Esslinger Zeitung und einen Stempel „Genehmigt Stv. Gen. Kom. XIII“. Die zensierten Wörter und Satzteile werden wir entsprechend durchgestrichen wiedergeben:
„Droben in N.W. hatte das ehrgeizige, mörderische Anrennen der künstlich erhitzten französischen Kolonnen gegen unsere Stellungen begonnen. Wie an scharfen Klippen zerschellten die Wogen, stürzten zurück, brandeten weiter der stählernen Küste entlang, die Aisne – Maas – Mosel hin und schlugen von den Weihnachtsfeiertagen an für Wochen mit tosendem Lärm an unserer festen letzten Flankenwacht um Thann – Sennheim – Altkirch und Dammerkirch empor.
Weithin stand in jenen Wochen der Sundgau unter Wasser und man mochte kaum glauben, dass in dem klebrigen Morast bis in neblige Ferne hin viele Tausende Brüder hausten in wassergefüllten, triefenden Gräben, dass in den öden Forsten und Brüchen draußen unsere Pioniere und Artilleristen die Feuerschlünde hatten einbauen können, die täglich einem starken Feind in vorzüglicher Höhenstellung grimme Wunden schlugen.
So sehr er rüttelte an der ehernen Pforte, vorwärts kommen sollte er nicht: Feuer spien die Wassergräben und Feuer die stummen Wälder. Tausende aus anstürmenden Kompagnien verbluteten vor unserem Verhau. Aber der Feind blieb im Vorteil. Er hatte die Höhen und um diese gings nun. Sch. u. A. u. S. u. U... Städte und Dörfer hinter der Front wimmelten von Soldaten, bei Nacht, ohne Licht, hinter stark verhängten Fenstern, verrammelten Türen, auf lichtlosen Straßen.
Deutsche Gespanne brachten Lebensmittel, Munition Werkzeuge, Draht, Bretter, Balken, Pfähle, ........ Draußen in der Nacht ein reges, stummes Schaffen. Aber dazwischen wie Gewittergrollen aus den Bergen, dann zuckende Blitze, tupfend, tastend über Wiesen und Felder hin – ein Bersten – Eisenscherbengeprassel. Und dazwischen immer wieder von hinten vor ein tiefer Bass, ein Feuerstreif. Bald schlägt der Brand auf – hier, da, dort – der Himmel brennt - . Auf 10 Stund Entfernung müssen die Menschen furchtsam auf den Straßen stehen und die Bewohner der im Feuer liegenden Ortschaften bejammern. Doch die gehen nachts, mit wenig Hausrat auf den Wagen, mit den Kindern fort – wohin?
Die Soldaten aber bleiben: heute, morgen, schon Wochen und – noch lange! Immer hinter stark verhängten Fenstern, in Kellern und Scheunen, in Gräben und Vertiefungen, nachts bei der Arbeit, beim Graben, Schaufeln, Hämmern, bei Granat- Schrapnell- und Gewehrfeuer, bei nächtlichen Brünsten auf Posten – oder schlafend auf Dielen im Stroh.
Am Morgen aber ist alles tot. Nur der Regenwind spielt mit den grauen, aschigen Kriegsfahnen, den Strichwolken von Brand und Schutt und führt sie in Fetzen zerrissen, melancholisch dahin streichend über die wassertriefende Landschaft nach Ost, von den Höhen herab, übers Tal hinweg – über den Rhein.
Die Höhen! Einst hatten wir sie. Dann nahm sie der Feind. Der wurde im Tal geschlagen und räumte Tal und Höhen. Wir nahmen sie nicht. Aber er kam wieder und befestigte sie – ein natürliches, umfangreiches, grandioses Fort. Heute sind sie für uns Fessel, Tod und Verderben. So darf es nicht bleiben. Wir müssen die Höhen haben!
Das neutrale Gebiet der Patrouillen, die Vorberge und Wälder werden besetzt, mit Feldwachen belegt, ausgebaut, unter sich verbunden, vorgeschoben. Auch der Feind hat neue Stellungen gebaut. Man kommt sich näher. Das Schießen hört nimmer auf. Das muss enden.
Ein Nachtangriff auf den nächsten Graben, fast lautlos, dann wildschreiend in Qual und Todesangst die einen, im Siegestaumel die anderen. Der Graben ist unser! Wir sind höher gekommen. Aber vor und über uns ist schon der nächste Graben. Nach Wochen gehört auch er uns. Er liegt schon im Schnee, 950 – 1000 Meter hoch.
Was mit Mühe und Blut gewonnen, wird treu verwahrt. Darum wird er fest ausgebaut. Über dem 1,5 Meter tiefen Schnee liegt fast täglich dichter Nebel und düstere Wolken. Die Bäume hängen zum Brechen voll Duft. Durchs Unterholz sieht niemand, durch die Kronen nur dann und wann – der Mond. An die dicksten Tannen, mit bis zum Boden neigenden Ästen werden Posten vorgeschoben. Auch sie graben sich ein im Schnee bis an den Kopf. Der äußerste Posten ist schon bloß mehr 10 Meter vom nächsten feindlichen Graben entfernt. Aber er weiß es nicht. Eine 2 Meter hohe Schneemauer ist vor ihm, außerdem der dichte Nebel – und er selbst ist in 24 Stunden Postenzeit ein gefrorener Schneemann geworden, mit weißem „Schießprügel“, so dick wie Skt. Christophorus Wanderstab.
Aber eines Tages wird’s doch helle. Der Wind beugt die Bäume, feiner Staub weht über den Boden, dann blickt der blaue Himmel durch. Die Posten schütteln und recken sich. Ihr Schimpfen und Selbstgespräch entdeckt sie sich gegenseitig. Sie ducken sich. Melden. Oben, unten werden die Wachen verstärkt, bis nach Tagen Mann an Mann steht.
Bald hebt ein Schießen an. Die Lage wird ungemütlich, für die äußersten Posten schwierig. So kanns wieder nicht bleiben. „Nein, so kanns nicht bleiben“, sagen sie auch am grünen Tisch, auf dem Regiment. Und sofort wird Tag und Stunde des Sturms ganz genau bestimmt. Zufällig trifft der kritische Moment in tiefsten Nebel und ins Schneetreiben. Der tüchtige Hauptmann stellt sich selbst an die Spitze seiner Kompagnie. Erst tüchtiges Feuer! Durch die Schneemauer hinauf, über sie herunter, ohne den Feind zu sehen. Daher außer den zermarterten Beinen wenig Verluste. Dann führt er die Züge den Schneewall hinauf unter Schlachtruf. Ein im Graben eingepickelter 56 Mann starker Zug der Feinde streckt schon größtenteils die Waffen, denn sie sind noch mehr erfroren als die Stürmenden. Mit Hallo werden die Gefangenen über die Stellung zu Tal befördert. Ein guter Mann, dieser Hauptmann, drum heißt die neue Stellung auch „Gutermannstellung“ und weil sie des Überblicks wegen, den sie auf die nächste Höhe gestattet, immer mehr befestigt werden sollte, ward sie schließlich zur Bastion. Drei Tage lang.
In der Nacht vom 25./26.II. kommt der Feind. Er will seinen Graben wieder, mit Urrääh – äh und unter unendlichem Lärm. Aber wir sind auf der Hut! Zwei Stunden lang rattern die Maschinengewehre, folgt Schuss auf Schuss. Dann nach und nach wieder Ruhe. Bloß das Stöhnen der Verwundeten vor dem Draht. Sie werden, so gut es geht, hereingezogen und fortgeschafft. Die meisten nicht. Sie flehen weiter, immer stiller. Am Morgen sind dutzende, nein hunderte länglicher Schneehügel vor den Drahtverhauen. Selten regt sichs nur unter einem – Nacht und Tod! Die zweite Nacht kommen sie wieder. Mehr dem Wald, dem Hang zu. Furchtbar rast das Feuer der Artillerie, erst auf den Graben, dann auf die Zufahrtstrasse vom Tal, um Unterstützung abzuschneiden. Das am kommenden Morgen enthüllte Bild war nicht weniger grauenhaft als das gestrige.
Am dritten Tag war eitel Sonnenschein auf den Höhen. In blendendem Weiß lagen die fast baumlosen Heideflächen über den welligen Rücken des Gerstenacker und des Großen Belchen. Mit stereoskopischer Deutlichkeit hoben sich die dunklen Spuren der Schützengräben und Drahthindernisse der feindlichen Stellungen von den Gefilden ab, und deutlich sah man auch die Posten aus ihrer Einsamkeit niederblicken. In reinstem Blau wölbte sich der Himmel und die Sonne schien eine Freude daran zu finden, Neuankömmlingen den Winterzauber und die Wunder der Hochvogesenwelt im schönsten Glanze zu zeigen.
Bewundernd stand ich so lange mit meinem Freund und Kameraden an der Brüstung unseres Grabens – O Krieg! Welchen Naturgenuss störst du uns! – Dann gingen wir ein paar Meter hinunter zu unserer Blockhütte! Im Schneegrab hakten, beilten, pickelten, schanzten wir an unserem halbfertigen Unterstand.
Da fingen die feindlichen Geschütze an zu sprechen, und wir verstanden sie sofort.
Unsere Hütte, unter einer mächtigen, schon hundertfach verbeilten Tanne am Waldrand, war, wie sie schien, das indirekte Ziel des feindlichen Feuers. Schon die ersten Geschosse schlugen in die Krone, in den Stamm ein. Stürzender Schnee, Duft, Äste begruben sofort uns eng im Graben an den Boden angeschmiegt liegende 7 Mann. Doch weiter tats nichts. Aber nun zu zwölfen, eins hinter dem anderen kamen sie, die Geschosse angerast, pfiffen, sangen, heulten an uns vorbei, zerschlugen die Stämme, brachen die Kronen, schmetterten die Eisenstücke klirrend umher, barsten, blitzten, krachten, schlugen dreien von uns die Glieder entzwei, im Graben unten einer ganzen Menge und heulten immer weiter – 2 Stunden lang.
Dann eine Pause. Still, feierlich, wie nach dem letzten Akt eines Dramas. Die Toten und Verwundeten wurden weggetragen. – Wer entbehrlich und gesund war, durfte abgehen; nur 3 Mann mussten bei unserem Gerät bleiben. Zwei Unteroffiziere lagen noch in der Hütte. Ich stand auf dem Weg. Der Leutnant: Drei bleiben! Wer bleibt? F. Sie? „Meinetwegen!“
Den Pickel zur Hand und graben! tiefer, tiefer. Der Boden ist wie Stahl. Schon 5 cm an einer Stelle. Da geht der Höllenspektakel von neuem los. Die gleichen ekelhaften Töne, der gleiche Lärm, die gleiche Todesfurcht, nun kommt das Feuer der platzenden Geschosse mehr zur Geltung, denn es will Abend werden. Und immer schneller scheinen sie sich zu folgen, immer eiliger scheinens die Feinde zu haben, als haben sie die Aufgabe, eine ganz bestimmte Menge von Geschossen zu verfeuern und als wollten sie zum Feierabend eilen. 1,5 Stunden dauerte dieses Schnellfeuer. 600 und mehr Geschosse hatten sie herüber geschickt in die Bastion. Eine Anzahl Toter lag drunten im Grab. Schwerverwundete röchelten auf den Wegen. Die Sanität eilte herbei.
Aber uns dreien hats nichts getan.
Unser Leben stand in Gottes Hand. Ich hatte gebetet. Wir kamen heil davon. In der Nacht kamen die Franzosen wieder und hatten so viele Tote als wir am Tag. Etliche Tage später war ich wieder wohlbehalten unten im Tal in G. Für unser Gerät war eine Ablösung aus einem anderen Regiment oben auf S. Zu ungewohnter Tageszeit kam plötzlich der Befehl: Alles auf S. Es war ein klarer Tag. Über Stadt und Stellung schwebten mehrere Flieger, die beschossen wurden, jedoch ohne Erfolg. Die runden Wölkchen entstanden immer erst hinter den Flugzeugen.
Auch von den Bergen heulten Geschütze. Unterwegs erfuhren wir, dass die Bastion verloren sei mit vielem Material. Unsere Bastion! Unser Todesangstplatz! Wir kamen hinauf und fanden alles in einem Zustand, ähnlich dem eines Ameisenhaufens, von dem ein Stück weggerissen oder eingeworfen wurde. Die Offiziere in eifriger Unterhandlung, die Unterbefehlshaber voller Aufträge und die Mannschaft emsig tätig beim Ausbau der alten Stellung oder an den Ausguckplätzen. Dorthin gingen auch wir. Und das war das Unterhaltendste. Wie sie schanzten drüben! Den Graben umkehrten! Zwar sah man fast immer bloß die Schaufeln und fallenden Erdballen. Aber dann und wann sprang doch wieder einer katzenbehend von einem Loch ins andere.
Mein Nachbar R. war ein grundbraver unverdorbener Mensch, aber auch ein guter Schütze und heute schoss er, denn er wollte sein Gewehr „rein bringen“, und außerdem mochte er die Blauröcke (Alpenjäger) nicht leiden. Auf dreimaliges Schießen traf er endlich, dass sein Partner, der auch herüber schoss jämmerlich zu schreien anfing. „Du warum schreien denn die Franzosen, wenn man sie trifft?“ fragte er mich ganz naiv, und ebenso ernst wie die Frage gemeint, antwortete ich ihm: „Nun wird ihnen eben weh tun!“ „Aber schreien, das ist doch kindisch“ entgegnete er.
Um übrigens dem Feind etwas Wermut in seinen Honig zu träufeln wurde seine eifrige Schanztätigkeit schnell telefonisch an unsere Artillerie gemeldet. Und diese nahm sich heute (ausnahmsweise) unser mehr an als sonst und feuerte. Bald schliffen sie daher, halb singend die kleinen von P. und J., höchst bedächtig, breitspurig und sehr unangenehm die 15er der Batterie H.
Die Erde bebte auch bei uns bei ihrem Einschlag – drüben aber grubs tiefe Löcher, schleuderte Balken, Steine, Körperteile in die Luft. Eine Pause der Todesfurcht drüben, dann Hilferuf und Angstgeschrei, und Hals über Kopf stürzten sie davon, den Berg hinauf, gefolgt von unseren kleinen Bohnen.
So gings eine Reihe von Tagen. Unsere Artillerie schoss jeden Tag meist einzelne Schüsse von 9 bis 2, 3, 4 Uhr. Dann hub die französische an, machte die Sache kurz und schleuderte in einer Stunde uns mehr Geschosse zu als die unsere den Franzosen im ganzen Tag. Wir waren deshalb recht unzufrieden mit ihr
Aber Verluste gabs täglich auf beiden Seiten. Drüben – wie mir schien – mehr als bei uns. Das tröstete und freute uns.
Bloß eines Tages kams anders. Es war hell. Unsere Artillerie hatte wieder begonnen, von mehreren Punkten aus zu feuern und die pulvergeschwärzten Löcher auf der ansteigenden, welligen Fläche zu vermehren. Drüben schiens eine Stunde tot. Dann vernahmen wir die uns bekannten Schläge, die Abschüsse der 7,5 und 9 cm Geschütze. Einzelne, dann mehr; sie kamen und platzten über unserer Stellung. Wir schlüpften in die 4-5 fach abgedeckten Unterstände oder duckten uns in den Graben.
Dann verstummten die Unseren. Von drüben aber kamen sie immer häufiger, wie Hagel – der Wald wurde lichter – wir lagen ruhig. Jetzt mischte sich ganz schwerer Sang in den Lärm – markerschütternd – von jenseits der Berge. Ein Koloß fiel in den Wald links hinunter. Nach 5 Minuten kam ein zweiter. Näher. Der folgende schon im untersten Ende eines Grabens. Die Eisenstücke schnurrten. Die Erde bebte. Ich hörte Rufe. Wieder 5 Minuten später grub sich ein Ungeheuer in eine Eckenstellung. Eine mächtige Tanne legte sich, wie selbstverständlich, den Krach verstärkend, auf die verschütteten Gräben. Wieder Rufen. Man grub die Begrabenen hervor. Für die nächste Granate hatte ich schon den Platz bestimmt. Felsblöcke von Tischgröße, ein Hagel von Steinen, Erde, Schnee, Balken – die Unterstände waren längst leer – abgedeckt – weggefegt -. Die ganze Stellung mit Gräben, Abdeckungen, Unterständen, Blockhäusern nur mehr ein unentwirrbarer Mischmasch von Baum, Fels, Boden, schwarzem Schnee, rote Spuren – Blut -.
Und immer noch der tolle Tanz, immer noch kein Schuß von unten. Aus fast allen Stellungen war die Mannschaft – Wehrleute – herausgeworfen – tot, verwundet (diese wurden zurückgeschleppt 100, 200 m) Dann halt! Hinlegen im Schnee! Auch das Feuer verlegte sich rückwärts. Vorn guckten die ersten Feinde herauf. Es kostete sie das Leben. Und erst in der Dämmerung anstürmende viele andere konnten unsere Tapferen, die in den Löchern geblieben waren, überwältigen. Bis spät in die Nacht währte der Lärm, das Blitzen und Krachen und Stöhnen. Dann Ruhe.
Vorn waren nun Franzosen, das war unsere Gipfelstellung. Wir zurück 100 Meter. 2 Compagnien, die bisher die unter vernichtendes Feuer genommenen Wege nicht heraufkonnten, kamen jetzt, die Erschöpften abzulösen. Wir hätten die Spitze wieder stürmen können, wir wussten und glaubten es sicher, denn das „Hurrah“ hat auch bei uns das brustkranke „Urrääh äh äh“ der Franzosen noch immer erstickt. Aber wozu? Was war vorn? Wollten wir in der zerwühlten Stellung ohne Schutz einen zweiten solchen Tag erleben? die vordere Stellung war dem Feind und auch uns auf den Meter hin bekannt. Hier zurück standen wir sicherer und nicht ungünstiger. Man beschloss sich einzubauen. Und bis der Morgen kam, wars teilweise schon geschehen. Die alte Stellung erfuhr aber heute eine neue Umkehrung, diesmal von unserer Artillerie. Die Franzosen mussten weichen.
Heute ist die Sudelspitze frei, neutral. Gelegentlich schauen unsere Patrouillen vor, kommen auch feindliche heimlich zur Einsichtnahme. Man ist sich wieder fremder geworden. Die Posten schießen selten, auch die Artillerie, die meiste ist fort.
Inzwischen sind die beiderseitigen Truppen in 2 benachbarten Engtälern, nahe der Grenze, wieder aufeinander geprallt, wos lange Wochen ruhig war. Über Nacht waren neue Verbände gekommen – tagelang wurde gestürmt, erobert, befestigt. Bis über den Rhein hörbarer Kampflärm, tage- und nächtelang. Dann wurde es auch dort wieder ruhig. In Nächten verschwanden die Truppen wieder. Neue Gräben ziehen sich – schon wieder beschneit – über Grenzkämme und vorgelegte Köpfe hin, tief in Schnee und Reif.
Drunten liegen die Täler schneefrei. Sonnenschein und zarter Nebel taut über der fernen Rheinebene, und friedlich schimmernd sieht der heimische Schwarzwald herüber. Hier oben späht lauernd der Tod im Eise, heut und morgen einzeln – zu seiner Stunde in unerbittlicher Ernte vollzieht sich ein Ringen und Kämpfen in wechselnder Heftigkeit, immer um dasselbe – um die Höhen, Gipfel und Kämme."